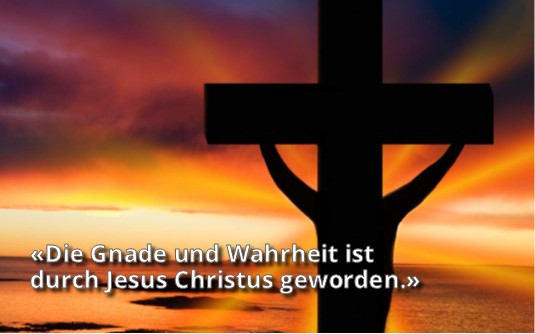Sicherheit im Wandel: Wie die Schweiz auf eine unsichere Welt reagiert
Die Welt ist im Umbruch. Globale Konflikte und technologische Sprünge fordern auch die Schweiz heraus – ein Land, das traditionell auf Neutralität und Eigenständigkeit setzt. Doch wie gut ist die Schweiz für diese neuen Herausforderungen gerüstet? Dr. Michael M. Olsansky ist Dozent für Militärgeschichte an der MILAK/ETH und erläutert im Gespräch mit Jan Leitz seine Beobachtungen zur Sicherheitspolitik, zur aktuellen Bedrohungslage, zum Wandel der Neutralität und zur Zukunft der Schweizer Armee.
Dr. Michael M. Olsansky Dozent an der MILAK, Militärhistoriker
Krisen, die keine Grenzen kennen
Die geostrategische Bedrohungslage ist so angespannt wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr. Der Ukraine-Krieg zeigt, wie schnell sich Konflikte zuspitzen können – mit weltweiten Folgen. «Niemand weiss, was kommen wird», erklärt Olsansky. «Wir sind nicht an der Front, aber die Krisen haben auch auf die Schweiz Auswirkungen.» Der Schutz des eigenen Territoriums bleibt oberste Priorität, doch die Neutralität steht immer wieder zur Diskussion. Besonders die Debatte um Waffenexporte zeigt, wie unterschiedlich Neutralität interpretiert wird – und wie fragil dieses Konzept sein kann.
Neutralität: Ein Konzept unter Druck
Neutralität ist kein Naturgesetz. Sie hat sich seit dem 17. Jahrhundert für die Schweiz historisch zu dem entwickelt, was sie heute ist. Ihre völkerrechtliche Kodifizierung erfolgte im 19. und frühen 20. Jahrhundert. «Damals war jedoch noch vieles anders. Es gab beispielsweise keine Raketen, die aus 3’000 km Entfernung und ohne Vorwarnzeit Ziele präzise zerstören können. Heute kommt das Konzept an seine Grenzen», betont Olsansky. Dennoch sieht er die Schweiz nicht unter massivem Druck, sich internationalen Allianzen wie der NATO anzuschliessen. «Die Nato fordert von der Schweiz keinen Beitritt. Als Admiral Rob Bauer, der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, im Dezember 2023 die Schweiz besuchte, machte er dies deutlich. Seine Haltung war frei ausgedrückt: Die Schweiz soll primär ihr eigenes Gebiet schützen. In zweiter Linie ist jeder Beitrag zur internationalen Sicherheit willkommen.»
Die Armee im Fokus: Back to Basics
Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs hat die Schweizer Armee ihre Prioritäten neu ausgerichtet. Nach jahrelangem Primat der Unterstützung der zivilen Behörden liegt der Fokus wieder auf der klassischen Landesverteidigung. «Die Verteidigungsfähigkeit wurde wirklich zu lange vernachlässigt», so Olsansky. Die Beschaffung moderner Kampfflugzeuge und Patriot-Raketen ist ein wichtiger Schritt, doch es bleibt viel zu tun.
Stärken und Schwächen: Wo die Armee steht
«Die Schweiz ist ein hochentwickeltes Land, das betrifft die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Industrie, das Technologieniveau und noch vieles mehr. Und vor allem verfügt die Schweiz über finanzielle Mittel und einen einigermassen ausgeglichenen Staatshaushalt. Das bedeutet, die Schweiz kann grundsätzlich selbst entscheiden, was für eine Armee sie haben will. Das ist bei vielen anderen Ländern, auch in der EU, nicht der Fall. Das Milizsystem erachte ich auch als Stärke, obwohl es auch Mängel hat – bspw. seit den 1990er Jahren bei der Offiziersrekrutierung. Technologisch ist die Luftwaffe nach wie vor gut aufgestellt. Allerdings muss sie jetzt erneuert werden. Und dann ist da der grosse rüstungstechnische Investitionsbedarf im Bereich der Bodentruppen, den die Armeeführung immer wieder thematisiert. Unsere Panzer und Geschütze sind teilweise 40 Jahre alt. Ohne Rüstungsersatz ist auch an Fähigkeitserhalt nicht zu denken, das heisst, die Armee kann ihre Kader und Soldaten ohne Waffen und Geräte nicht schulen. Es ist am Schluss eine politische Frage, welche Armee die Schweiz möchte.»
Aber auch die gesellschaftlichen Umbrüche wirken sich stark aufs Militär aus. Einerseits wäre da der Geburtenrückgang zu erwähnen, andererseits aber auch der Fachkräftemangel. «Wir haben zwar mit dem Milizsystem eine breite Abdeckung von Fachwissen, aber halt nicht spezifisches militärisches Fachwissen. Hier besteht ein grosser Bedarf an militärischem Berufspersonal. Und nun sehen wir, dass in den nächsten zehn Jahren ein Drittel des Berufskaders pensioniert wird. Dadurch gehen wiederum Kompetenz und Fachwissen verloren, welche aufgrund des Fachkräftemangels nicht einfach aufgefangen werden können. Ähnliche Probleme hat die Privatwirtschaft. Allerdings ist diese in der Lage, bspw. Pflege-Fachpersonen oder Wissenschaftler einfach aus dem Ausland zu «importieren». Das geht halt bei der Schweizer Armee nicht.»
Drohnen-Angriffe: Die unsichtbaren Gefahren
Moderne Kriegsführung verlagert sich zunehmend in die digitale und technische Sphäre.
Drohnen stellen dabei eine doppelte Gefahr dar: als Waffen und als Spionagetools. «Die Entwicklung effektiver Drohnenabwehrsysteme läuft auf Hochtouren», erklärt Olsansky. Besonders vielversprechend sei hier bspw. das «Jamming», also das Stören von GPS-Signalen oder neue Luftabwehrmunitionsarten. «Auf eine rüstungstechnologische Invention folgt in der Regel die Gegeninvention. Mit dem Auftauchen des Panzers war dieser für Jahrzehnte das dominierende Kriegsgerät. Man konnte zunächst wenig gegen diese neue Waffe unternehmen. In der Folge fokussierte man sich auf die Entwicklung von Panzerabwehrwaffen und heutzutage sind Panzer «auf dem Gefechtsfeld selbst stark gefährdet». Ähnliches könnte künftig bei den Drohnen passieren.»
International vernetzt, aber autonom
Die Schweiz arbeitet seit Jahren in internationalen Friedensmissionen wie der KFOR oder in militärischen Beobachtungsmissionen der UNO (bspw. im Nahen Osten) mit anderen Staaten zusammen. Der Beitritt zur «European Sky Shield Initiative», einem europäischen Luftverteidigungsnetzwerk, zeigt, dass Kooperation und Autonomie Hand in Hand gehen können. «Die sogenannte «Fremde Hilfe» steht nicht im Widerspruch zur Neutralität», betont der Experte. «Im Fall eines Angriffs auf die Schweiz ist Unterstützung durch den Gegner des Gegners neutralitätsrechtlich erlaubt. Dabei sollten wir aber darauf achten, nicht in falsche Abhängigkeiten zu geraten. Das haben wir grad jüngst in der Ukraine gesehen: Als Elon Musk damit drohte, dort sein «Starlink» abzuschalten, wurden plötzlich sehr viele sehr nervös.»
Die grössten Herausforderungen der Zukunft
Was bereitet dem Militärhistoriker die meisten Sorgen? «Die Zeit der einfach zu antizipierenden und kalkulierbaren Risiken ist vorerst mal vorbei», warnt er. Zum einen zeigt sich der Krieg in Europa wieder in seiner vermeintlich vergangenen, konventionellen Brutalität. Moderne Waffenentwicklungen wie Hyperschallraketen, Drohnen und die Bedrohungen aus dem Cyber-Raum machen die Verteidigung zudem immer komplexer.
«Auch wenn ich Infanterieoffizier bin, erachte ich den Schutz des eigenen Luftraums als höchstes Gut – und der fängt eben halt nicht in Buchs SG an der schweizerisch-österreichischen Grenze an.» Der Schutz des Luftraums steht daher neben der Modernisierung der Bodentruppen für die Armeeführung ganz oben auf der Agenda.
Botschaft an die Bevölkerung: Wachsam bleiben
Zum Abschluss richtet Dr. Olsansky eine klare Botschaft an die Schweizer Bevölkerung: «Wir dürfen uns nicht in falscher Sicherheit wiegen. Niemand kann vorhersagen, was die Zukunft bringt. Aber angesichts der geopolitischen und kriegerischen Entwicklungen der letzten Jahre wäre es definitiv töricht, für die Zukunft nur in bequemen «Normalfallszenarien» zu denken.»